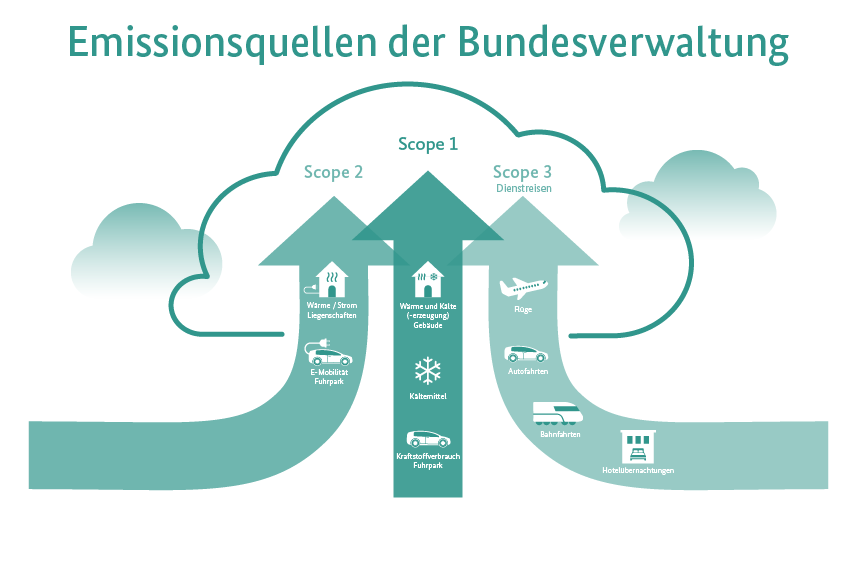Bereits vor den Verwerfungen auf den Energiemärkten ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine haben sich Behörden der Bundesverwaltung Maßnahmen zum Klimaschutz und zu Energieeinsparungen umgesetzt. So wurden mit der Umsetzung von Energie- und Umweltmanagementsystemen die entsprechende Kompetenz und Strukturen aufgebaut, um Energieverbräuche in den Bundesliegenschaften systematisch zu erfassen, zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten.
Basierend auf diesen Erfahrungen hatte die KKB im Juni 2022 im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ressortübergreifend Vorschläge zu zehn sofort umsetzbaren Maßnahmen verdichtet und zur Prüfung und Umsetzung in der Bundesverwaltung auf freiwilliger Basis empfohlen. Im Winter wurden diese und die bis zum April 2023 geltenden Vorgaben für öffentliche Nichtwohngebäude der EnSikuMaV um ein sogenanntes Winter Update ergänzt.
Für diesen Herbst-Winter 2023/2024 spricht die KKB eine Empfehlung zur Fortsetzung der Sofortmaßnahmen und Vorgaben der mittlerweile ausgelaufenen EnSikuMaV aus. Hierdurch sollen die im letzten Jahr unternommenen Anstrengungen der Behörden zur CO2-Einsparung aufrechterhalten werden und die Bundesverwaltung ihrer Vorbildfunktion nachkommen.
Wichtig ist, dass die Behörden weitere Anstrengungen unternehmen, alle ihre Mitarbeitenden zu sensibilisieren, zu schulen und zu motivieren. Dazu gehört auch, dass neben den Beschäftigten das Reinigungs- und Sicherungspersonal eingebunden wird. Eine möglichst breite Akzeptanz aller Verantwortlichen ist notwendig, um auch in den Bundesbehörden weitere Maßnahmen mit dem Ziel der Klimaneutralität umsetzen zu können.
Einen Überblick über die von der KKB empfohlenen Maßnahmen zur Energieeinsparungen in der Bundesverwaltung erhalten Sie hier:
- Winter Update: Sofortmaßnahmen der Bundesverwaltung zur Energieeinsparung (PDF, 113 KB)
- Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung der Bundesverwaltung (PDF, 110 KB)
- Verordnung zur Sicherheit der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen – EnSikuMaV