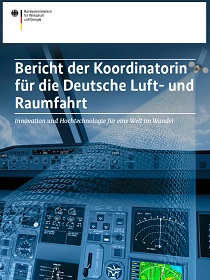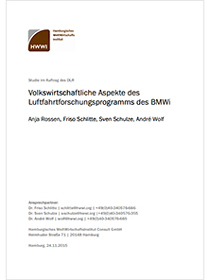Die Luftfahrtbranche folgt dem Trend vieler Industriezweige hin zu immer kürzeren Innovationszyklen bei gleichzeitig steigenden Produktanforderungen an Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.
Die Förderung der Luftfahrtindustrie ist zum einen allgemeines Ziel der vom Bundeskabinett 2014 verabschiedeten Luftfahrtstrategie der Bundesregierung.
Darüber hinaus setzte sich die Bundesregierung das strategische Ziel: eines klimaneutral hergestellten, betriebenen und gewarteten Flugzeugs. Der Koalitionsvertrag 2021 – 2025 sieht ferner vor, Deutschland zum „Vorreiter beim CO₂-neutralen Fliegen“ zu machen. Das bedeutet: Aus Deutschland heraus mitzuhelfen, den Luftverkehr insgesamt klimaneutral und umweltgerecht zu gestalten - mit neuen, postfossilen und erneuerbaren Kraftstoffen, effizienteren Technologien und der Arbeit an alternativen Antrieben.
Der Fokus der zukünftigen Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich Luftfahrt liegt bei der Reduzierung der CO₂-Emissionen sowie der sog. NonCO₂-Wirkungen des Luftverkehrs, insbesondere durch die Bildung von Kondensstreifen.
Bezogen auf die CO₂-Emissionen des Verkehrsbereichs in Deutschland liegt der Anteil des innerdeutschen Flugverkehrs bei 1,2%. Die präzise Abschätzung der NonCO₂-Wirkungen des Luftverkehrs ist derzeit noch Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung.
Ziel ist langfristig das Zero-Emission Flugzeug, das zunächst (bis 2035) als Demonstrator in der Klasse eines kleinen Regionalflugzeugs realistisch ist.
Eine Teilhabe an der Schaffung eines umweltverträglicheren Luftverkehrssystems kann nur mit einer leistungsfähigen und innovativen Luftfahrtindustrie in enger Zusammenarbeit mit den anderen maßgeblichen Akteuren erreicht werden.
Ein wesentliches Instrument ist deshalb die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation. Hiermit setzt die Bundesregierung Anreize für Unternehmen, verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren.
LuFo-Klima
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?2
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?1
Um die technologische Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrtindustrie dabei nachhaltig zu unterstützen, fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz diese Branche durch das eigenständiges Luftfahrtforschungsprogramm-LuFo Klima. Für das Siebte nationale zivile Luftfahrtforschungsprogramm (LuFo Klima VII) werden Mittel zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Verfügung gestellt. Anknüpfend an die Erfolge des sechsten Programms fördert das Bundeswirtschaftsministerium leistungsfähige Forschungsnetzwerke aus Wissenschaft und Wirtschaft, die den gesamten Innovationsprozess von der Idee bis zur industriellen Verwertung abdecken.
Mit dem im April 2024 veröffentlichten, ersten Programmaufruf (LuFo Klima VII-1) wurde eine noch stärkere Fokussierung auf ein zukünftiges klimaneutrales Luftverkehrssystem gelegt. Mit dem Ziel, diesen Transformationsprozess der Luftfahrtbranche bestmöglich zu unterstützen, wird LuFo KLima deutlich stärker als in der Vergangenheit auf neue Klimaschutztechnologieentwicklungen hin ausgerichtet. Die Ausrichtung von LuFo Klima basiert dabei auf drei Säulen:
- Alternative klimaneutrale Antriebssysteme,
- Reduktion des Primärenergiebedarfs und Ressourceneinsatz durch Reduktion des Gewichts sowie durch Erhöhung der Effizienz von Antrieben, der Systeme und der Aerodynamik, sowie
- Reduzierung der Fertigungszeiten und -kosten mit dem Primat geschlossener Stoffkreislaufsysteme.
Hierbei werden grundsätzlich mittelfristig bis 2035 folgende primäre Zielgrößen angestrebt:
- Reduktion des Gewichts um 40%,
- Reduzierung des Energiebedarfs um 50% sowie
- Reduzierung der Fertigungskosten und -zeiten um 50%.
Gleichzeitig bleiben die weiteren Ziele zur Beibehaltung der hohen Sicherheit und zur Reduzierung des wahrgenommenen Lärms um 50% erhalten.
Vor diesem Hintergrund werden Technologieentwicklungen unterstützt, die das Fliegen nachhaltig, klimaneutral und sicher machen. Als Orientierungsmarken dienen 5 Zeithorizonte in den vorrangigen Flugzeugklassen.
Kurze Umsetzungshorizonte werden bei unbemannten Fluggeräten (UAV) ermöglicht.
- CS-23 Klasse (leichte Motorflugzeuge) bis 2028,
- Regionalflieger bis 2030,
- Mittelstrecke (Single Aisle) bis 2035 und
- Langstrecke (Wide Body) bis 2045.
Die ersten Technologiebausteine müssen mit einem Vorlauf von 3 Jahren ab 2025 validiert sein. Die entwickelten technischen Lösungen und Konzepte stellen einen wesentlichen Beitrag für einen nachhaltigen Luftverkehr dar und stärken somit die Wettbewerbsposition des Luftfahrtstandorts Deutschland.
Weitere Schwerpunkte Digitalisierung und Industrie 4.0. Hierbei liegt der strategische Fokus vor Allem auf der Entwicklung modernster, digital gestützter Produktionssysteme und fortschrittliche Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI). Zudem wurde die erfolgreiche Förderlinie für kleine und mittlere Unternehmen weiter ausgebaut.
Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandorts Deutschland müssen unter anderem Entwicklungszeiten und -kosten entscheidend gesenkt werden, ohne die technologische Leistungsfähigkeit der Produkte zu beeinträchtigen. Die Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zielt daher auf die Entwicklung von Technologien für Luftfahrzeuge und Antriebe mit direktem und indirektem Umwelt- und Klimabezug, etwa alternative, elektrifizierte Antriebe und konsequenter Leichtbau sowie Verfahren zur Effizienzsteigerung von Fertigungs- und Produktionsverfahren bei gleichzeitiger Steigerung des Qualitäts- und Sicherheitsniveaus. Insgesamt stärkt die Förderung die technologischen Kernfähigkeiten der deutschen Luftfahrtindustrie und sichert die Technologieführerschaft in zukunftsträchtigen Bereichen.
Das Luftfahrtforschungsprogramm wird durch Mittel aus dem Klima-Transformations-Fond (KTF) unterstützt. Hier werden ausschließlich Technologie-Projekte mit einer direkten Verbesserung der Klimawirkung des Luftverkehrs gefördert, für den Themenschwerpunkt wurde eine separate Bekanntmachung (LuFo Klima VII-1 KTF) veröffentlicht.
Zur effizienten Verwendung der zur Verfügung stehenden Ressourcen ist das Luftfahrtforschungsprogramm eng mit den verschiedenen Förderprogrammen der Bundesländer und der Europäischen Union abgestimmt.
Luftfahrt-Entwicklungs-Darlehen
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?3
Mit Blick auf die Anforderungen der Dekarbonisierung der Luftfahrt steht die gesamte Branche vor einem gewaltigen Umbruch, der gravierende Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette entfaltet – von Forschung und Entwicklung bis hin zu Produktion und Betrieb. Dekarbonisierung und Transformation stellen eine große Herausforderung dar, eröffnen zugleich aber auch neue Chancen. Um den Umbruch aktiv gestalten und ihre Rolle in der Transformation optimal ausfüllen zu können, müssen die Luftfahrtunternehmen aber die notwendigen Kernfähigkeiten auf- und ausbauen. Vor allem für die kleineren Unternehmen wird es darauf ankommen, sich rechtzeitig auf diese Entwicklung einzustellen und ihr Produktangebot entsprechend anzupassen.
Aufgrund des hohen Risikos und der langen Entwicklungszeiten ist es für viele insb. kleine Luftfahrt- unternehmen schwierig, Neuentwicklungen selbst zu finanzieren oder hierfür Kredite am privaten Kapitalmarkt zu erhalten. Insofern leistet die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und zum Ausbau der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von entsprechenden Unternehmen.
An die Förderkette anknüpfend wurde als weiterer Baustein zur Unterstützung das Luftfahrt- Entwicklungs-Darlehen (Nachfolger des Luftfahrzeugausrüsterprogramms) für Forschungs- und Technologievorhaben der zivilen kommerziellen Luftfahrt am Standort Deutschland mit einer Laufzeit bis Ende 2028 veröffentlicht. Ziel ist, den Transformationsprozess zu einer klimaneutralen, umweltverträglicheren, lärmminimierten, leistungsfähigeren, sichereren und passagierfreundlicheren Luftfahrt voranzutreiben.
Mit Luftfahrt-Entwicklungs-Darlehen sollen Finanzierungsmöglichkeiten für Forschungs- und Technologieentwicklungsvorhaben geschaffen werden, deren Finanzierung nicht durch Bankkredite zu angemessenen Konditionen sichergestellt werden kann. Entwicklungs-, Markt- und Programmrisiken sollen durch das Luftfahrt-Entwicklungs-Darlehen vermindert und die Finanzierungslücken bei der Einführung neuartiger Technologien geschlossen werden. Die Förderung besteht aus verzinslichen, teilweise bedingt (stückzahlabhängig) rück-zahlbaren Darlehen.
Das Programmvolumen liegt bei 300 Mio. Euro für die gesamte o.g. Laufzeit und die Darlehen werden durch die KfW ausgereicht.
Für die neue Förderperiode (2024 - 2028) wurden einige Neuerungen eingeführt, um das Förderprogramm einerseits auf die aktuellen politisch-strategischen Ziele der BReg (insbes. Voraussetzungen schaffen für eine „saubere“, d.h. klimaneutrale Luftfahrt) auszurichten und andererseits seine Attraktivität innerhalb der Luftfahrtbranche zu erhöhen:
- Stärkere Fokussierung auf Reduzierung des Ressourcenverbrauchs sowohl in der Fertigung als auch im Betrieb von Luftfahrzeugen; Reduzierung der CO₂-Emissionen sowie Vermeidung/Minimierung von sonstigen Klimaeffekten.
- Ausweitung des Adressatenkreises über Ausrüster/Zulieferer hinaus auch auf OEM, weil sich in jüngster Vergangenheit gezeigt hat, dass mit Blick auf das gegenständliche Förderprogramm eine strikte Trennung zwischen OEM auf der einen und Zulieferern / Ausrüstern auf der anderen Seite nicht mehr sinnvoll ist. Die Bedingungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordung (AGVO) finden weiterhin Anwendung (siehe Bekanntmachung).
- Höhere Fördersätze, gestaffelt nach Unternehmensgrößenklasse (KU – max. 55%, MU – max. 45%, GU – maximal 40%), um die besondere Förderwürdigkeit der KMU hervorzuheben. Dabei wurde berücksichtigt, dass der beihilferelevante Teil weiterhin bei max. 25% liegt und nur der beihilfeirrelevante Teil erhöht wurde.